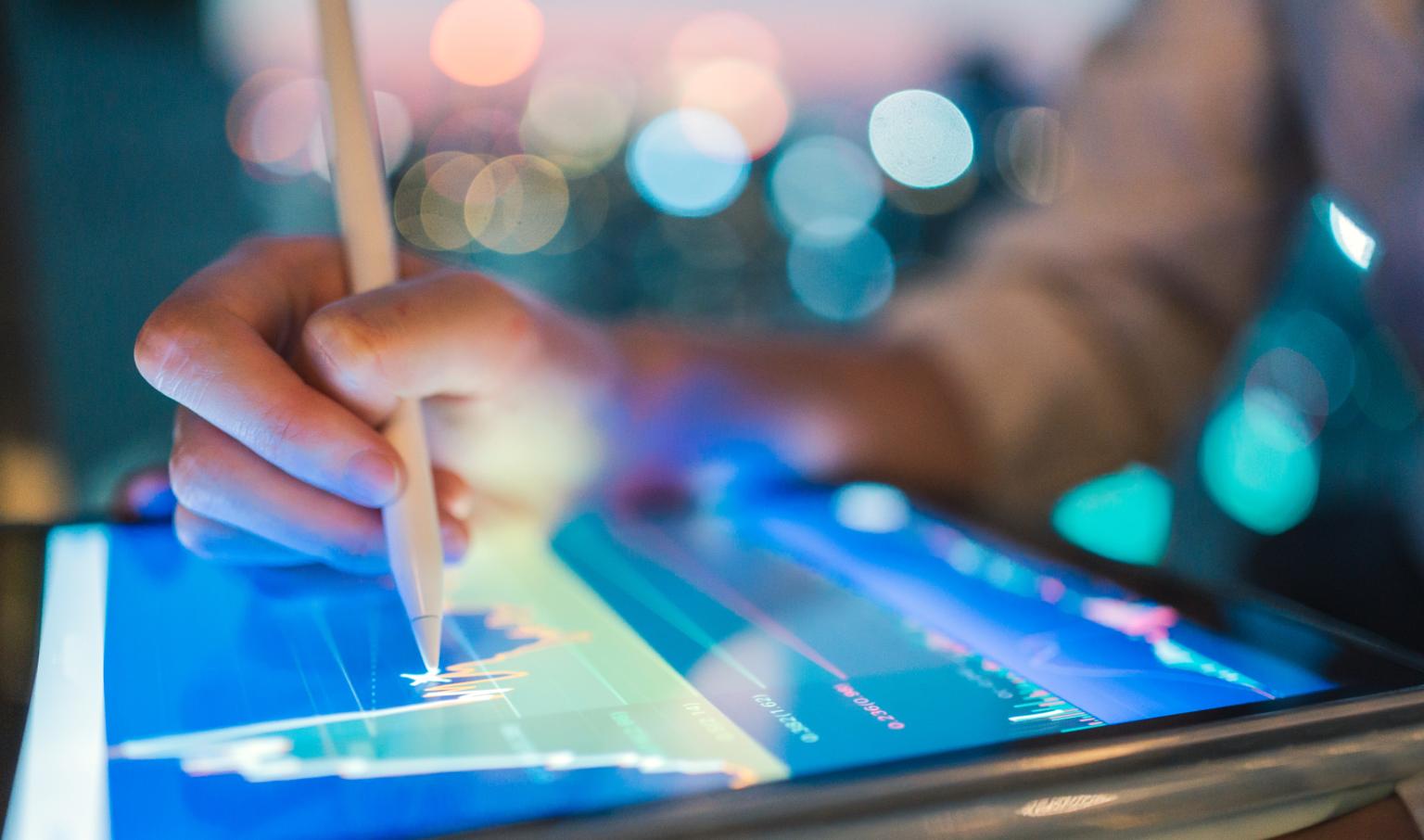Was sind Zölle und wie schützen sie die heimischen Produzent:innen?
Zölle sind Abgaben, die beim Grenzübertritt von Waren erhoben werden, und so gewissermassen einen «Eintrittspreis» für ausländische Produkte darstellen. In der Schweiz werden diese Zölle heute vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erhoben und erfüllen drei Hauptfunktionen: Sie bringen dem Staat Einnahmen, schützen die eigene Wirtschaft und lenken den Handel. So mussten bis 2023 beispielsweise für Lederschuhe aus Italien oder Spanien Zölle von bis zu 8 Franken pro Paar entrichtet werden. Auch für Äpfel aus Polen oder Neuseeland, die während der Schweizer Erntesaison eingeführt werden, fällt ein Zoll an, mit dem Ziel, Schweizer Bäuerinnen und Bauern vor Billigimporten zu schützen. Diese Abgaben verteuern ausländische Produkte und unterstützen somit indirekt die heimische Produktion.
Zölle waren immer auch ein politisches Steuerungsinstrument
Im Mittelalter waren Zölle eine wichtige Finanzierungsquelle für Städte und Fürsten. Händler:innen mussten Gebühren zahlen, etwa an Brücken oder Stadtgrenzen. Im 17. und 18. Jahrhundert dienten Zölle dann verstärkt dem wirtschaftlichen Schutz, etwa durch Abgaben auf Textilien oder Metallwaren, um die heimische Produktion zu fördern. In der Schweiz wurde mit der Bundesstaatsgründung 1848 ein Flickenteppich kantonaler Zölle abgeschafft. Das neue nationale Zollsystem erleichterte den Handel und stärkte den Binnenmarkt.
Aus ökonomischer Sicht fördert der Zollabbau den internationalen Handel, weil Länder sich stärker auf jene Produkte spezialisieren können, bei denen sie komparative Vorteile haben. Dadurch steigen die Effizienz und der Gesamtnutzen im Handel. Zölle hingegen führen oft zu sogenannten Wohlfahrtsverlusten, da sie zu höheren Preisen, ineffizienter Produktion und eingeschränktem Konsum führen. Damit wandelt sich eine einstige Schutzmassnahme in ein potenzielles wirtschaftliches Risiko.
Zollabbau entlastet Firmen und Konsument:innen – mit Ausnahmen
Seit dem 20. Jahrhundert setzen viele Länder auf Freihandel statt Abschottung. Abkommen wie EFTA oder Verträge mit der EU reduzierten viele Zölle. Die Schweiz schaffte 2024 sämtliche Industriezölle ab, etwa auf Kleidung, Maschinen und Fahrräder.
Die Gründe: Zölle verursachten hohen Verwaltungsaufwand bei geringem Ertrag. Mit dem Abbau sparen Firmen jährlich rund 100 Mio. CHF. Importpreise sanken, was auch Konsument:innen entlastete. In der Landwirtschaft schützen Zölle jedoch weiterhin die heimischen Schweizer Produzent:innen.
Das US-Beispiel zeigt: Zölle können die Wirtschaft bremsen
Die USA nutzen Zölle seit jeher auch strategisch. 1930 erhob das Smoot-Hawley-Gesetz massive Einfuhrzölle auf Tausende Produkte. Ziel war der Schutz heimischer Arbeitsplätze, doch der Effekt war fatal: Handelspartner reagierten mit Gegenzöllen, der Welthandel brach ein, die Weltwirtschaftskrise verschärfte sich.
Knapp 90 Jahre später setzte Donald Trump als Präsident in seiner ersten Amtsperiode (2017–2021) erneut auf Abschottung. Unter dem Motto «America First» erhob er hohe Zölle auf Importe, vor allem aus China. Die Folgen waren höhere Produktionskosten, internationale Spannungen und sinkender Handel.
Nach seiner Wiederwahl 2024 verschärfte Trump seinen Kurs. Schnell wurden Zölle auf chinesische Waren sowie pauschale Erhöhungen für Konsumgüter eingeführt. Die Argumente sind erneut Schutz vor Billigimporten, Rückholung von Produktion und nationale Stärke. Das Ausmass der erhobenen Zölle übertraf die kühnsten Erwartungen und die Kritik wächst: Ökonom:innen warnen vor höherer Inflation, Gegenmassnahmen der Handelspartner und gestörten Lieferketten. An den Finanzmärkten führten die Zollerhöhungen zu deutlichen Kursverlusten, vor allem bei international tätigen Unternehmen.
Ob die aktuelle Zollpolitik den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg für die USA bringt oder die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, bleibt offen. Im Gegensatz zu 1930 ist die Ausgangslage heute stark globalisierter und die gegenseitigen Abhängigkeiten von Wirtschaftsnationen signifikant. Damit sind die mit der Zollpolitik einhergehenden Risiken beträchtlich.
Unsicherheit an den Märkten erfordert klare Strategien
Die Unsicherheiten an den Finanzmärkten bleiben vorerst ein ständiger Begleiter auch in Phasen wirtschaftlicher Erholung. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Kursschwankungen werden uns wohl weiterhin begleiten. Entscheidend ist eine Anlagestrategie, die auf Stabilität und langfristiges Denken setzt. Wer breit diversifiziert investiert, kann selbst unvorhergesehene Ereignisse besser abfedern. Sprechen Sie mit Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Berater, um Ihr Vermögen optimal zu investieren.